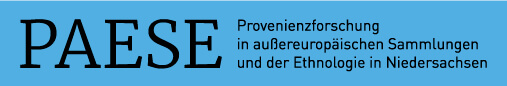Die kolonialen ethnologischen Sammlungen im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim
Rekonstruktion von Sammlungsbiografien und regionalen Netzwerken
Hauptschwerpunkt des Hildesheimer Teilprojektes war eine Untersuchung einzelner sehr heterogener Sammlungen sowie deren Erwerbungsgeschichte, die einen zentralen Aspekt der jeweiligen Objektbiografien darstellt. Durch Recherchen im Hildesheimer Stadtarchiv sowie die Herbeiziehung weiterer Dokumente in anderen Archiven und sonstiger Quellen (Kolonialdokumente, Reiseberichte, Tagebücher etc.), die bislang in der Forschung wenig Beachtung gefunden haben, wurden Sammelstrategien in der Zeit vor 1918 herausgearbeitet. Die Aufmerksamkeit galt dabei zugleich den Sammler*innen, über die in vielen Fällen noch wenig bekannt war und deren Rolle im Kontext des Erwerbs von Sammlungen in der Kolonialzeit.
Erwerbungen von Objekten aus den deutschen Kolonien, aber auch aus Gebieten anderer Kolonialmächte aus dem Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin waren 2017/2018 bereits Gegenstand eines von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine geförderten Vorgängerprojektes. Regionale Schwerpunkte des PAESE-Teilprojektes waren Sammlungen aus Ozeanien (Museum Godeffroy), Afrika (Namibia) und Indonesien/Niederländisch Indien (Sammlung Muhlert). Mit berücksichtigt wurden vor dem Hintergrund der zu untersuchenden Sammlungsnetzwerke auch weitere bedeutende, teils von Hildesheimern angelegte Sammlungen (z. B. Sammlung Stelling aus Sulawesi), deren Erwerb den Beziehungen Hermann Roemers und der ihm nachfolgenden Direktoren Achilles Andreae und Rudolf Hauthal zu verdanken ist und über deren Hintergründe Dokumente im Hildesheimer Stadtarchiv Aufschlüsse versprachen.
Bereits in der Geburtsstunde des Museums 1844 zählte die Ethnologie explizit zu den Sparten des von den Gründern geplanten „Weltmuseums“, für die Objekte und Sammlungen erworben werden sollten. Entsprechend spiegelt die ethnologische Sammlung die Kolonisierung der außereuropäischen Welt. Allgemein lässt sich feststellen, dass im Hildesheimer Museum die Bestände aus Ozeanien und Afrika zwischen 1871 und 1918 bedeutend zunahmen. Ein gezielter Erwerb von Objekten aus den deutschen Kolonien nach 1884 konnte als mögliche Sammlungsstrategie nicht nachgewiesen werden.
Ziel des Teilprojektes war eine Darstellung der kolonialen Erwerbungszusammenhänge der einzelnen Sammlungsbestände. Untersucht wurden die Herkunft der Objekte, die Sammler (Biografien), Art und Umstände des Erwerbs (Kontext vor Ort) sowie der jeweilige Kontext der Musealisierung.
Das Projekt ist im Dezember 2021 ausgelaufen. Projektbezogene Anfragen richten Sie bitte an die Teilprojektleiterin Dr. Andrea Nicklisch.

Im Rahmen des Projektes entstand die Sonderausstellung „Modische Schwergewichte aus Namibia. Traditionelle Kleidung und Schmuck der Herero-Frauen“, die vom 11. Februar bis 8. November 2020 im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim zu sehen war.

(C) RPM, Foto: Sh. Shalchi.
Kontakt:
Projektbearbeiterin: Dr. Sabine Lang
Teilprojektleiterin: Dr. Andrea Nicklisch
ehm. Direktorin: Prof. Dr. Regine Schulz (Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim)